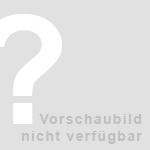Unna sieht sich angesichts der Klimaveränderungen mit bedeutenden Herausforderungen konfrontiert. Eine neue Klimaanalyse des Regionalverbands Ruhr (RVR) für das Stadtgebiet zeigt die Dringlichkeit des Handelns auf und beschreibt, wie den klimatischen Veränderungen entgegengewirkt werden kann. Für jeden Stadtteil gibt es konkrete Hinweise.
Heiße Sommer, milde Winter
Laut der Analyse hat sich das Klima in den vergangenen Jahrzehnten signifikant verändert. Die Durchschnittstemperaturen steigen. Die Sommer sind heißer geworden, mit einer zunehmenden Zahl von Hitzetagen, die Temperaturen von mehr als 30 Grad erreichen. Diese Entwicklung werde durch milde Winter ergänzt, in denen die Temperaturen seltener unter den Gefrierpunkt fallen.
Die Temperaturzunahme werde voraussichtlich anhalten, das habe zur Folge, dass die Intensität und Häufigkeit von Starkregenereignissen zunimmt. Eine doppelseitige Herausforderung: Zum einen steige das Risiko von Überschwemmungen, zum anderen nehme die Wasserknappheit in Dürreperioden zu.

„Es wird deutlich, dass die höchste Wärmebelastung mit einer starken bis extremen Wärmebelastung fast ausschließlich auf die Gewerbe- und Industriegebiete im Stadtgebiet von Unna beschränkt ist“, heißt es in der RVR-Analyse. Demnach weisen aber auch die Innenstadt, Königsborn und Massen – Gebiete mit einem erhöhten Versiegelungsgrad – eine starke Wärmebelastung auf.
Aus der Analyse ist eine „Planungshinweiskarte“ für Unna entstanden. Aus dieser geht beispielsweise hervor, dass der Ausbau von vorhandener Wohnbebauung nur in der Innenstadt nicht empfohlen wird. Die Stadtverwaltung erarbeitet seit einiger Zeit ein Baulandprogramm, das die Wohnungsnot beheben soll.
„Klimatische Baugrenzen“
Die Analysten des RVR ziehen aber auch „klimatische Baugrenzen“. Sie sollen klimatisch wertvolle Räume schützen. So wird von einer Ost-Erweiterung des Industrieparks an der Werler Straße (B1) abgeraten. Auch der Bornekamp ist demnach ein wichtiger Bereich.
Es wird geraten, die Grün- und Waldflächen dort auszubauen. Dazu heißt es in der Analyse: „Am Beispiel des Bornekamps wird ersichtlich, dass durch Grünvernetzungsstrukturen innerstädtischer Grünflächen mit dem unbebauten Freiland ein Luftmassentransport bis weit in einen Siedlungskörper hinein erfolgen kann.“
An zwei weiteren Stellen des Stadtgebiets sollten zudem keine größeren Baugebiete mehr entstehen: an der Grenze zu Dortmund – westlich von Massen sowie zwischen dem Afferder Weg und der Bebauung entlang der Vaersthausener Straße in Königsborn.

Im Folgenden werden beispielhaft Planungshinweise für jeden einzelnen Stadtteil aufgelistet: Massen und Afferde werden als westlicher Teil des Stadtgebiets zusammengefasst. Für das Gewerbegebiet an der Nordstraße wird vorgeschlagen, auf eine Bebauung oder Bepflanzung am südlichen Rand zu verzichten, „um den Kaltluftzufluss nicht zu unterbinden“. Im Bereich des Massener Hellwegs sollten nicht nur weitere Straßenbäume gepflanzt, vielmehr auch Hinterhöfe entsiegelt und begrünt werden.
Entlang der Bahntrasse und der A1 wird eine weitere Begrünung vorgeschlagen. Für die Bauarbeiten der neuen Eisenbahnbrücke und am Kreuz Dortmund/Unna waren im vergangenen Jahr erst 4000 Bäume an der Unnaer Straße gefällt worden. Erst nach Abschluss der Arbeiten soll die Fläche wieder aufgeforstet werden.
Grünes Band in Königsborn
Für Königsborn schlägt der RVR vor allem eine weitere Begrünung ausgehend vom Kurpark vor. So soll ein grünes Band mit dem unbebauten Umland entstehen. Die Hauptverkehrsachsen wie die Friedrich-Ebert-Straße sollten zudem entlastet werden.
Die Innenstadt (Mitte) werde durch seinen hohen Grad an versiegelten Flächen geprägt. Dementsprechend sei das Vermeiden zusätzlicher Bebauung wichtig. Bei Ersatzbauten solle der Grünanteil erhöht werden. Mit dem Umbau des Platzes am Morgentor und der geplanten Neugestaltung des ehemaligen Parkplatzes an der Schulstraße gibt es zwei Projekte, die bereits zu einer weiteren Begrünung beitragen.

Für Billmerich heißt es in der Analyse unter anderem: „Die Ausweisung kleinerer Neubaugebiete ist aus stadtklimatischer Sicht vertretbar.“ Dabei sollte das Zusammenwachsen mit dem Siedlungsbereich „Am Busch“ aber verhindert werden, um den Kaltluftabfluss in den Talverlauf des Liedbachs nicht zu unterbinden.
Auch in Mühlhausen/Uelzen und Kessebüren sowie– Lünern und Hemmerde – sei der Bau kleinerer Neubaugebiete unproblematisch. Darüber hinaus wird geraten, die Freilandflächen als Kalt- und Frischluftproduzenten zu erhalten.
Zur Methode der Klimaanalyse
Der Regionalverband Ruhr erstellt nach eigenen Angaben seit 40 Jahren Stadtklimaanalysen für seine Verbandskommunen. Diese basierten in der Vergangenheit häufig auf einem aufwändigen Messprogramm mit Ergebnissen in geringer Detailschärfe. Für die Analyse der Stadt Unna seien hingegen die Ergebnisse einer für die gesamte Metropolregion Ruhr durchgeführten Klimamodellierung aus dem Jahr 2020 genutzt worden.
„Dieses Verfahren liefert im Gegensatz zu den lokal begrenzten Messungen, umfassende, räumlich hochauflösende und vor allem flächendeckende Ergebnisse zu einer Vielzahl klimarelevanter klimatischer Parameter“, heißt es vom RVR. Die mehr als 200 Seiten lange Klimaanalyse lässt sich im Ratsinformationssystem der Stadt Unna finden.
Höllenhitze nimmt zu: In Unna ist es heißer als anderswo in Deutschland
Schwarzgrün getrennt auf Wohnungssuche: Das Baulandprogramm in Unna enthält Zündstoff
Autobahnbauer müssen in Unna 4000 Bäume ersetzen: A1-Brücke ist fertig, Wald muss warten
Grünanlage statt Parkplatz in Unna: Der Platz am Morgentor ist eröffnet
Neue Spiel- und Grünfläche im Herzen von Unna: Der Zeitplan für den Minette-Pötter-Park