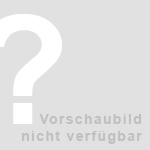Der Stadt Unna drohen durch die Reform der Grundsteuer Einbußen in Millionenhöhe. Trotzdem sollen die Bürger nicht weiter belastet werden. Im Gespräch mit Tobias Hinne-Schneider hat Bürgermeister Dirk Wigant (56) erklärt, wie er das schaffen möchte. Und warum eine Fahrradspur auf dem Verkehrsring nur schwer umzusetzen ist.
Der Stadt droht durch die Grundsteuer-Reform ein Verlust von drei Millionen Euro. Um Kämmerer Michael Strecker zu zitieren, „das ist bei gegebener Haushaltslage indiskutabel“. Ist eine Erhöhung der Grundsteuer unumgänglich?
Die Verwaltung versucht, es zu vermeiden. Wir können es noch nicht genau sagen. Im November haben wir eine Steuerschätzung vor uns. Dann können wir sagen, wie es austariert wird. Aber meine Priorität lege ich darauf, die Gewerbesteuer moderat zu erhöhen, bevor wir die Grundsteuer anfassen.
Höffner hatte im Zuge der geplanten Ansiedlung eines Service-Standortes Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 500.000 Euro versprochen. Konnte sich die Stadt die Ablehnung leisten?
Es ist ja keine Frage von leisten oder nicht leisten, sondern von Prioritäten. Man muss sagen, dass das Finanzausgleichssystem in Nordrhein-Westfalen von Land zu Kommune sehr komplex ist. Die Firma Höffner könnte gar nicht 500.000 Euro versprechen oder garantieren. Das kann auch nie Voraussetzung für eine Genehmigung sein.
Die komplexe Finanzausgleichssituation bedingt, dass 90 Prozent von diesen 500.000 Euro, wenn es denn so viel wären, ab dem nächsten Jahr nicht mehr für die Schlüsselzuweisung gelten würden. Durch den kommunalen Finanzausgleich, den wir vom Land bekommen, würde die Summe unserer Finanzkraft angerechnet. Das heißt, wir würden weniger Geld vom Land bekommen.
Und der Rat hat aus verschiedensten Gründen entschieden und gesagt, es soll nicht wieder ein neuer Logistikstandort sein, in Kenntnis dessen, dass uns da sicherlich ein paar Einnahmen verloren gehen. Wir haben nicht mehr so viel Grund und Boden für Gewerbebetriebe und wir müssen sehr sorgfältig selektieren, wen wir dort ansiedeln möchten. Und die Entscheidung, die wir da getroffen haben als Rat der Stadt, halte ich für richtig.

Vor Kurzem hat das Aluminiumwerk bekannt gegeben, dass eine geplante Investition von mehr als fünf Millionen Euro in eine Mitarbeiter-Akademie nicht umgesetzt wird. Einer der Gründe sei die „unmotivierte Erhöhung der Gewerbesteuer durch die Stadt Unna ab 2025“, hieß es vom Unternehmen. Was macht die geplante Gewerbesteuererhöhung dennoch wichtig, obwohl Unternehmen sich gegen Investitionen vor Ort entscheiden?
Ob diese Entscheidung unmittelbar mit der Gewerbesteuer zu tun hat, wage ich zu bezweifeln, denn ob sich etwas rentiert oder nicht, richtet sich nicht nach der Höhe der Gewerbesteuer.
Die Kommune hat zwei Steuern zur Verfügung, die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, wo sie die Hebesätze definieren kann. Und in der Vergangenheit war es eben so, dass die Grundsteuer in Unna schon relativ hoch war, bis 2020 auch regelmäßig erhöht wurde, zuletzt auf 843 Punkte.
Vor dem Hintergrund, dass die Reform der Grundsteuer die Bewohner Unnas weiter zur Kasse bittet, die Gewerbetreibenden im Schnitt aber um zwei Drittel entlastet werden, war es unsere Meinung, dass wir diesmal nicht wieder über die Grundsteuer gehen.
Wir müssen unsere Einnahmen erhöhen. Die Aufsichtbehörde fordert, dass wir für die nächsten vier Jahre nachweisen, wie die Stadt ihren Haushalt ausgleichen will. Deswegen sind wir auf diesen Wert von 595 Punkte ab 2025 gekommen.
Wir haben schon kommuniziert, dass es dabei nicht bleiben wird, sondern dieser Gewerbesteuersatz, aufgrund eines sehr guten Jahresabschlusses im letzten Jahr, um mindestens 25 Punkte gesenkt wird. Und wir suchen nach weiteren Möglichkeiten, um ihn zu senken. Die Wahrheit ist aber, wir werden am Ende bei der alten Gewerbesteuer nicht auf den alten 481 Punkten bleiben können.
Unsere Nachbarkommunen sind stark in die Grundsteuer gegangen. Wir sind im Verhältnis gar nicht mehr so hoch bei der Grundsteuer. Und ich finde es unfair, wenn wir bei der Grundsteuer, so wie das Finanzamt uns das ja aufkommensneutral vorschlägt, nochmal 25 Prozent drauflegen. Wir würden die Bürger doppelt bestrafen.
Zum einen müssten sie durch diese Grundsteuer-Reform das auffangen, was durch die geringere Neuberwertung der Grundstücke von Unternehmen bei der Grundsteuer fehlt und müssten noch mal ihre eigenen höheren Beiträge – jeder, der jetzt seinen Messbescheid vom Finanzamt bekommen hat, wird das sehen – bezahlen.
Um die Gewerbesteuer zu erhöhen, gibt es zwei Möglichkeiten, am Hebesatz zu schrauben oder neues Gewerbe in die Stadt zu locken. Wie wichtig ist es, Neuansiedlungen zu ermöglichen?
Es gibt eine dritte Möglichkeit, die wir nicht außer Acht lassen sollten. Das ist die Bestandspflege. Das heißt, wir müssen mal schauen, wie viele sehr erfolgreiche Unternehmen in Unna tätig sind, hier investieren und eben noch mehr Gewinne generieren. Da kann ich Zapp nennen. Ich kann Dachser nennen, die im Gewerbegebiet bauen. Wir sind attraktiv. Das haben wir nicht nur bei Höffner gesehen.
Es gibt viele Firmen, die nach Unna kommen wollen und es gibt viele, die investieren und hier bleiben wollen. Wir müssen die Möglichkeiten schaffen, dass das gelingt. Es gibt noch freie Gewerbegebiete: An der Stadtgrenze von Königsborn nach Kamen; die Provinzialstraße wird als neues Gewerbegebiet mittelfristig erschlossen, sodass wir für einen absehbaren Horizont von fünf bis zehn Jahren sicherlich Flächen haben. Aber wir müssen früh genug daran arbeiten, dass es dann weitergehen kann.
Parkhäuser immer in der Nähe
Die Umgestaltung des Morgentores ist abgeschlossen. Der Umbau des Parkplatzes an der Schulstraße läuft. Wie bewerten Sie diese Projekte?
Beides ist bisher sehr gelungen, auch, weil das die Zukunft der Innenstädte ist. Aufenthaltsqualität schaffen und die Eingangsbereiche stärken – das ist wichtig, gerade wo Gastronomie zu Hause ist, um ein gutes Bild nach außen abzugeben und die Leute in die Stadt hineinzulocken. Wir haben sehr gute Kompromisse, selbst was das Parken angeht, an den Stellen gefunden.
Sie haben das Parken angesprochen. Beide Projekte werden kritisch gesehen, weil Parkplätze weggefallen sind.
Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, weil ich selbst oft genug in der Situation war, dort einen Parkplatz zu suchen. Aber es ist, glaube ich, jedem zuzumuten, die Parkbauten zu nutzen. Es ist kein Parkhaus weiter als 100, 150 Meter von der Fußgängerzone entfernt.
Wir haben über 4000 Parkplätze und es geht im Kern nicht um die Abschaffung von Parkplätzen, sondern die Lenkung des Verkehrs. Deswegen haben wir als Stadt beschlossen, dass wir die Preise leicht erhöhen für die oberirdischen Parkplätze, um den Suchverkehr möglichst herauszuhalten aus der Stadt.
Die Maßnahmen passen in das neue Verkehrskonzept der Stadt. Welche Ziele verfolgt die Stadt mit ihrer Verkehrsplanung?
Es war mir ein wichtiges Anliegen, die verschiedenen Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt zu Wort kommen zu lassen. Dafür haben wir den Masterplan Mobilität mit externer Hilfe erarbeitet, unter Beteiligung der Bürger. Am Ende sind wir alle Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger und ÖPNV-Nutzer. Es ist wichtig, Kompromisslösungen hinzubekommen. Klimaschutzförderung, klimafreundliche Mobilität bis hin zur Intensivierung des Radverkehrs, ganz klar, das ist der Lauf der Zeit, das wollen wir auf jeden Fall tun.
Jetzt gibt es im Konzept den philosophischen Satz: „Jeder Weg beginnt zu Fuß und endet auch so.“ Da ist viel Wahres dran. Und dazwischen soll es langsamer werden: Mehr Tempo 30 auf Straßen ist ein Vorschlag.
Das Reduzieren von Tempo ist keine Willkür. Es gibt einen Lärmaktionsplan, der ist uns EU-rechtlich vorgeschrieben. Und wenn es uns nicht gelingt, Lärme weiter herunterzubringen als über Geschwindigkeitsbegrenzung, dann ist das das letzte Mittel der Wahl. Wir werden prüfen, ob es vielleicht auf bestimmte Tages- oder Nachtzeiten zu beschränken ist.

Großes Thema im Konzept ist der Radverkehr. Jetzt herrscht beim ADFC, der Interessenvertretung der Radfahrer, nicht nur Freude, sondern auch ein Stück weit Frust. Es wird an der Umsetzungsgeschwindigkeit gezweifelt. Jährlich sollte Unna 1,8 Millionen Euro in den Radverkehr investieren. Wie kann das Geld gut investiert werden?
Zunächst mal verstehe ich den ADFC, weil er schon jahrzehntelang auf bestimmte Maßnahmen wartet. Auf der anderen Seite muss die Stadt das Wohl aller Verkehrsteilnehmer im Auge haben.
Es ist klar, dass nicht alles von heute auf morgen umgesetzt werden kann. 1,8 Millionen Euro wären schön, wenn wir die hätten. Das ist eine Empfehlung des nationalen Radverkehrsplans, der von 30 Euro pro Einwohner und Jahr ausgeht. Das ist so gar nicht umzusetzen. Trotzdem werden wir an verschiedenen Stellen Radwege schaffen. Als Erstes werden wir die Fröndenberger Straße in Kessebüren und die Provinzialstraße in Massen anfassen.
Noch immer ist die Idee auf dem Tisch, eine Spur auf dem Ring für den Radverkehr zu schaffen. Wird das weiterverfolgt?
Das wird weiterverfolgt. Wir waren gerade zum Jahresgespräch bei Straßen NRW. Die sind Eigentümer der Straße. Man muss immer fragen, wie weit sie etwas mitgehen. Wenn man sich alleine Linksabbieger- und Rechtsabbieger-Möglichkeiten ansieht, müssten wir überlegen, ob wir auch gegenläufigen Radverkehr zulassen oder ob wir es nur in eine Richtung erlauben. Es ist hochkomplex, das umzusetzen. Und vielleicht favorisieren wir den Weg, das mehr innerhalb des Rings zu machen. Wir haben ja mittlerweile einen Radring.
Unna fehlen Wohnungen
Was bei der Verkehrsplanung fertig ist, soll es auch fürs Wohnen geben: Ein Handlungskonzept samt Baulandprogramm. Es soll helfen, Mittel gegen die Wohnungsnot zu finden. Mit welchen Problemen sieht sich die Stadt konfrontiert? Und wie sehen Lösungen aus?
Wir haben zu wenig kleine Wohnungen, die bezahlbar sind. Das wollen wir als Erstes angehen. Dadurch werden Umzugsketten in Gang gesetzt. Das heißt, wenn jemand sein Einfamilienhaus altersbedingt oder aus anderen Gründen verlassen möchte, geht er in eine kleinere Wohnung und das Haus wird frei für Familien.
Die Kollegen haben gut 40 Baulandflächen gefunden. Wir nehmen Kontakt mit den Eigentümern auf, inwiefern diese bereit wären, etwas zur Verfügung zu stellen. Es wird in diesem Herbst wahrscheinlich zum Abschluss gebracht, welche Flächen denn jetzt vorrangig angegangen werden.
Wie begegnen sie jungen Familien, die jetzt auf der Suche nach Bauland sind?
Ich kann sie nur um etwas Geduld bitten, bis wir das Baulandprogramm haben. Das andere ist, mal zu fragen, warum die Gesellschaften, die aktuell Baurecht für Flächen haben, es nicht umsetzen. Das gilt für das Gebiet im Kissenkamp und für die Brockhausstraße, wo die UKBS tätig werden soll. Oder man hat das Glück, eine Baulücke zu finden.
Jetzt zieht die Falkschule in den neuen Bildungsstandort am Hertinger Tor. Das ist eine innerstädtische Fläche, die in absehbarer Zeit frei wird. Gibt es schon Planungen?
Ja, es gab ja schon Planungen vor zwei bis drei Jahren. Die Frage der Nachnutzung ist interessant. Jetzt haben wir als Zwischenlösung angedacht, das Hellweg-Museum dort einziehen zu lassen, weil wir die Burg dringend sanieren müssen. Aber wenn das Museum zurückziehen kann, ist eine Nachnutzung in Form von Wohnen gut denkbar. Erstinteressenten gibt es, das ist auch publiziert.
Jetzt haben wir über mehr Wohnraum, mehr Platz für Gewerbe gesprochen. Das bedeutet im Umkehrschluss, es wird mehr Fläche versiegelt.
Es muss am Ende immer noch die Möglichkeit geben, ein Einfamilienhäuschen bauen zu können. Das ist mein Ziel, aber wir werden verstärkt über Geschosswohnungsbau nachdenken.
Eine sehr gute Lösung ist allerdings, wenn man gar nicht neu versiegelt, sondern Brachen angeht. Ich freue mich sehr, dass es nach Jahrzehnten gelungen ist, die Victoria-Brache anzufassen.
*Hinweis: Das Interview ist in dieser Form gekürzt. Das komplette Gespräch finden Sie auf hellwegeranzeiger.de als Video.