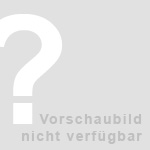Ein Jahr ist nun vergangen, seitdem Unna an der Gebührenschraube für Parkplatznutzer gedreht hat. Unter freiem Himmel fordern die Ticketautomaten seitdem 2,50 statt 1,50 Euro pro Stunde. Der Sinn der Maßnahme sollte aber nicht darin bestehen, mehr Geld einzunehmen, sondern Autofahrer zur Fahrt in die meist günstigeren Parkhäuser zu bewegen.
Die erste Jahreserfassung mit möglichen Auswirkungen des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes liefert viele Zahlen, die auch mit Blick auf die Einführung eines Parkleitsystems wichtige Diskussionsgrundlagen liefern können. Was das Konzept gebracht hat und was nicht, lässt sich nun zum Teil ablesen.
Nur drei Prozent mehr Nutzer in den Parkhäusern
Was das Hauptziel angeht, die Parkverkehre in die Tiefgaragen zu leiten, schaffen die Statistiken von Stadt und WBU zunächst Ernüchterung. Rund 562.000 Kurzzeitparker haben im vergangenen Jahr eine Tiefgarage oder ein Parkhaus der Wirtschaftsbetriebe Unna angefahren. Das entspricht einem Zuwachs von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Bevor das Konzept als Fehlschlag eingestuft wird, sollten aber noch die Entwicklungen im laufenden Jahr zu betrachten sein. Denn für den Fall, dass Autofahrer sich einfach noch schwer damit tun, Alternativen zu ihren gewohnten Parkquartieren unter freiem Himmel überhaupt zu finden, verspricht das geplante Parkleitsystem weitere Impulse.
Weniger Besucher oder kürzere Besuche?
Kritiker des Parkkonzepts hatten die Befürchtung angeführt, dass sich der Park- und Kundenverkehr vielleicht nicht in die Großgaragen verlagern würde, sondern in andere Städte. Ob dies geschehen oder ausgeblieben ist, lässt sich mit der Statistik der Stadt nicht sauber beantworten. Denn die Anzahl der ausgegebenen Parkscheine an den Automaten unter freiem Himmel lasse sich aus technischen Gründen nicht ermitteln.
Eher als Indiz taugen die Gesamteinnahmen der Freiluftparkplätze. Sie summierten sich im Jahr 2024 auf rund 680.000 Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um fast 25 Prozent.

Aber: Da der Gebührensatz um fast 67 Prozent gestiegen war, ist zumindest rechnerisch belegt, dass die Anzahl der bezahlten Parkstunden gesunken ist. Ob dies nun auf einen Rückgang der Besucherzahlen in der Innenstadt schließen lässt oder durch kürzere Aufenthalte zu erklären ist, lässt sich aus den Zahlen aber nicht herauslesen.
Mehr Knöllchen und doch weniger Einnahmen
Einen interessanten Befund liefern nun – allerdings gesamtstädtisch – diejenigen, die aufs Lösen eines Parkscheins, das Stellen einer Parkscheibe oder auf die Einhaltung anderer Regeln gänzlich verzichten: Die Zahl der ausgestellten Knöllchen stieg im vergangenen Jahr um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 23.828 Mal bat das Ordnungsamt Autofahrerinnen oder -fahrer zur Kasse.
Die Einnahmen, die damit erzielt wurden, sanken allerdings um rund 17 Prozent auf nur noch 522.164,26 Euro.
Für den optisch deutlichen Anstieg der Fallzahl hat die Stadt eine einfache Erklärung: 2023 lagen die Zahlen außerordentlich niedrig, weil einige Personalabgänge im Ordnungsamt erst mit Stellenneubesetzung und Einarbeitung ausgeglichen werden mussten. Auf längere Sicht gesehen seien der Kontrolldruck und/oder die Regelbefolgung der Verkehrsteilnehmer eher stabil.
Schmerzhafter Lerneffekt für Falschparker?
Für den Umstand, dass die Stadt trotz einer Rückkehr zur gewohnten Knöllchenzahl weniger Geld einnimmt, kann die Stadt mangels einer systematischen Auswertung nur auf eine Hypothese zurückgreifen: Die Neufassung des Bußgeldkataloges lässt die Schere zwischen den Strafsätzen für einfache und für schwerwiegende Verstöße weiter auseinanderstreben. Der ein oder andere mag dadurch gelernt haben, dass etwa das Parken auf dem Gehweg doch kräftig ins Geld gehen kann. So kämen bestimmte Arten des Falschparkens tatsächlich seltener vor, während es in der Breite der Verstöße wenig Veränderungen gibt.