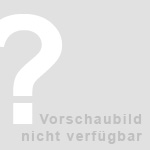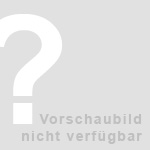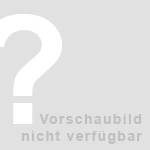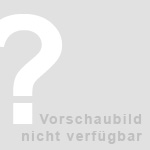Es kam immer mehr Unvorhergesehenes dazu. Das trieb die Kosten vor allem bei dem komplexen IGA-Bauwerk über die Lippe in Lünen in die Höhe. Erst waren es Schwierigkeiten mit dem Untergrund, dann Mehrkosten für die Kampfmittelsondierung, dadurch erschwerte Arbeiten am Flussufer in den Wintermonaten und letztlich geänderte Schweißnähte. Probleme, die trotz punktueller Bohrungen und Prüfung der Ausführungspläne durch einen Statiker nachträgliche Änderungen ergeben hätten, wie die Stadt seinerzeit erklärte.
Kosteten die Brücken im August 2024 bereits 7,3 Millionen, muss die Stadt inzwischen 8,6 Millionen Euro zahlen. Damit wird die im November 2023 erteilte Auftragssumme um 1,6 Millionen Euro überschritten. Was bedeutet das für die EU-weite Ausschreibung? Hat die Stadt durch nachträgliche Kosten möglicherweise gegen das Vergaberecht verstoßen? Fragen, die sich Konkurrenten stellen mögen, die bei dem öffentlichen Auftrag nicht zum Zuge kamen.
Die Stadt Lünen hingegen sieht sich trotz der Mehrkosten, die sie ohne Belastung des ohnehin defizitären Haushalts aus dem IGA-Budget stemmen will, auf dem richtigen Weg. „Die Preisänderungen bei den IGA-Brücken verstoßen nicht gegen das Vergaberecht“, heißt es auf Nachfrage der Redaktion aus der Pressestelle. Bei größeren Bauprojekten seien Nachträge möglich und in bestimmten Fällen vorgesehen, erklärt Pressesprecher Alexander Dziedeck. Etwa dann, wenn sich im Laufe der Arbeiten zusätzliche Leistungen als notwendig erweisen. Dafür gebe es klare Regeln, die hier eingehalten worden seien.

Rechnungsprüfung kontrolliert
Der Auftrag sei im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung vergeben worden. Eine Beschränkung auf kleine oder mittlere Unternehmen sei dabei nicht zulässig, teilt Alexander Dziedeck mit. Entscheidend sei, dass der Bieter fachlich geeignet sei und die Anforderungen der Ausschreibung erfülle. Das gesamte Verfahren werde von der örtlichen Rechnungsprüfung begleitet und die politischen Ausschüsse regelmäßig über den Stand der Kosten informiert. „Durch die Einbindung der Gremien ist auch für die Öffentlichkeit nachvollziehbar, wie sich das Projekt entwickelt“, stellt Alexander Dziedeck klar.
Genaue Projektbeschreibung
Auf Nachfrage der Redaktion beim Städte- und Gemeindebund heißt es, dass man zu dem konkreten Sachverhalt in Lünen keine Auskunft geben könne. Ganz generell gelte aber, dass für öffentliche Auftraggeber die jeweils zu erstellende Leistungs- beziehungsweise Projektbeschreibung der Schlüssel sei, um mögliche Nachträge gering zu halten beziehungsweise ganz zu verhindern. Das sei auch im (Bau)Vergaberecht so angelegt.
Laut Städte- und Gemeindebund sei jeder öffentliche Auftraggeber gut beraten, vor einer Ausschreibung eines Projekts alle denkbaren und vertragsrelevanten Daten und Anforderungen zu prüfen und zu definieren, damit die anbietenden Unternehmen wüssten, „was auf sie zukommt und wie sie das Angebot kalkulieren müssen“. Hierzu zähle bei Bauprojekten unter anderem auch eine gründliche Vorfelduntersuchung zur Bodenbeschaffenheit.
Bei der juristischen Betrachtung komme es im Einzelfall darauf an, „was für den öffentlichen Auftraggeber objektiv erkennbar war beziehungsweise was der Auftraggeber zumutbar hätte ermitteln müssen.“ Sollten trotzdem einmal „unvorhersehbare“ neue Umstände hinzukommen, die vorab für niemanden erkennbar gewesen seien, dann seien „zusätzliche Arbeiten nachzubeauftragen und natürlich auch nachträglich abzurechnen.“ Dies sei ärgerlich, aber nicht immer zu vermeiden. „Derartige Preissteigerungen verstoßen insoweit auch nicht gegen das Vergaberecht.“