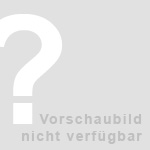An die Woche, die sein Leben veränderte, fehlt Steve B. jede Erinnerung. Heute ist er 48, damals 41. Nach jahrelangen Drogenexzessen landete er zur Entgiftung in einer Klinik – mal wieder. „Da musste ich so mit Medikamenten voll gekleistert werden, dass ich mich an die erste Woche gar nicht mehr erinnern kann.“ Danach macht es Klick; er merkt, dass es so nicht weitergehen kann. Jeder Rückfall in die Heroin- und die Alkoholsucht könnte der Letzte sein, das machen ihm die Ärzte klar.
Im Sommer 2024 ist Steve B. fast sechs Jahre komplett abstinent. Seinen Lebenslauf kennt er „schon fast auswendig“, so oft hat er ihn auf dem langen Weg aus der Sucht schon erzählt. Seine Gegenfrage lautet dann: „Wen wollen sie kennenlernen? Den Menschen oder den Süchtigen?“
Der Mensch Steve B. wurde 1976 geboren, in Halle an der Saale, damals noch in der DDR. Wann der Süchtige Steve B. geboren wurde, ist etwas schwieriger zu erklären, vermutlich aber schon 15 Jahre später, kurz nach der Wende.
Nazi oder Punk?
Aufgewachsen sei er in einer „ganz normalen DDR-Familie“, wie er sagt: mit zwei Geschwistern, Mutter und Stiefvater im Plattenbau. Doch sein Erzeuger – das Wort Vater kommt für ihn nicht infrage – starb schon mit 40 Jahren. Er war alkoholkrank. Als Steve B. sieben Jahre alt ist, kommt das junge Box-Talent in eines der für die DDR typischen Sportinternate. Der Alltag ist genau durchgetaktet: fünf Tage die Woche Training, viele Wettkämpfe. Ansonsten früh Aufstehen, Schule, klare Regeln, gemeinsame Mahlzeiten. Nach Hause geht es nur am Wochenende.
Als 1989 die Mauer fällt, ist Steve B. 13 Jahre alt. Die Sportschule schließt, der Box-Traum ist vorbei. Der Teenager zieht wieder zu Hause ein. Doch nicht nur den erwachsenen Menschen in der nun ehemaligen DDR setzen die plötzlichen Veränderungen zu. „Ich würde sagen, ich komme aus einer Knackpunkt-Generation“, sagt Steve B. Seine Schwester wollte Pilotin werden, wurde am Ende Kassiererin bei Aldi.

Zurück in der Schule habe er sich dann ein „eigenes Umfeld gesucht“. Steve B. hat die Wahl: Nazi oder Punk? „Ich habe Omi versprochen, ich werde alles, nur kein Neonazi“, erzählt er: „Dafür bin ich, glaube ich, auch zu schlau – auch wenn spätere Entscheidungen vielleicht nicht den Eindruck machen.“ Denn als Punk will er provozieren. Das erste Bier des Tages gibt es für den 15-Jährigen schon morgens in der Hofpause. Kiffen probiert er auch aus, doch davon bekommt er Beklemmungen. Durch Alkohol hingegen fühlt sich der eigentlich schüchterne Junge stärker, cooler. Die Angst ist weg. Heute weiß er, dass er mit 16 wohl schon psychisch alkoholabhängig war. Auch chemische Drogen wie Speed, Ecstasy oder LSD probiert er aus.
Doch Punk zu sein bedeutete mehr aus nur provozieren und Bier trinken. Immer wieder gibt es gewalttätige Aufeinandertreffen mit lokalen Neonazis in Halle. An Vatertag wird der 16-Jährige angestochen. Heute werden die 1990er Jahre, in denen Rechte vor allem im Osten Deutschlands Gewalt gegen Andersdenkende ausübten, auch Baseballschlägerjahre genannt. Auch mit dem machte Steve B. schmerzhafte Erfahrungen.
Halle die Drogenhochburg
Überhaupt war Halle damals ein hartes Pflaster. Und eine Drogenhochburg: Zwei Minuten in der S-Bahn, und schon seien einem Drogen angeboten worden. Auch aus anderen Oststädten kommen Menschen an die Saale, um Drogen zu kaufen. Nachdem es in der DDR offiziell keine Drogen gab – und „außer bei den Reichen wohl auch wirklich nicht“, wie Steve B. schätzt –, fehlt jetzt ein Suchthilfesystem. Nur drei Ärzte in Halle hätten Hilfe für Suchtkranke angeboten; die Wartelisten sind für viele der Süchtigen viel zu lang. Über seine eigene Alkoholsucht macht sich Steve B. damals noch keine Gedanken. Schließlich zittere er nicht und sei nicht andauernd schweißgebadet. Nur wer so aussehe, sei Alkoholiker. Mit dieser Denke ist er nicht alleine. Oftmals dauert es 15 oder sogar zwanzig Jahre, bis eine Alkoholsucht erkannt wird. Bei Drogen geht es meist schneller.
Aber es bleibt für Steve B. auch nicht beim Alkohol. Als die erste große Liebe eine unglückliche wird, kauft der gerade Volljährige zum ersten Mal „H“. Ein Pulver in der Farbe von Vollmilchschokolade, das er zunächst raucht und später durch die Nase zieht. Als er erfährt, dass „H“ für Heroin steht, ist er schon abhängig. Das führte im Laufe der Jahre so weit, „dass ein Bekannter mir irgendwann die Spritze in den Hals setzen musste, weil ich keine brauchbaren Venen im Arm mehr fand“. Noch heute sagt er auf die Frage, wie es sich anfühlt, Heroin zu nehmen: Einsamkeit, Sorgen, Ängste, all das sei plötzlich weg. Stattdessen mache sich eine Geborgenheit im ganzen Körper breit. Trotzdem will er die Droge nie wieder anfassen.

Denn in dieser Zeit gerät sein Leben erstmals aus den Fugen. Die junge Liebe bleibt toxisch und seine Ausbildung zum Elektroniker schmeißt Steve B. nach nur einem Jahr hin. Die Fehlzeiten waren zu viele geworden. Da kommt die Einberufung zum Wehrdienst gerade recht. Auch hier gibt es zwar Alkohol, allerdings meist nur am Wochenende. Und das ist immerhin weniger als vorher – und auch als nachher. Wie schon im Sportinternat helfen dem jungen Mann auch hier die klaren Hierarchien und Strukturen. Gerne wäre er länger geblieben, doch nach einer möglichen Ausbildung fehlten die Perspektiven.
Nach einem Jahr Bundeswehr beginnt er stattdessen wieder eine Ausbildung, dieses Mal zum Elektroinstallateur. Das Ergebnis? „Wie bei der ersten und wieder die gleiche Frau“, sagt er und muss schmunzeln: „Damals war das aber nicht so feierlich.“ Zu Hause knirschte es langsam und sein Stiefvater sei ohnehin nie ein großer Fan von ihm gewesen. Doch der nächste Versuch sitzt, Steve B. schließt die Ausbildung dieses Mal endlich ab – sogar mit sehr gut. Die Suchtkrankheit bleibt trotzdem.
„Ein Teufelskreis“
An den Wochenenden reist der 21-Jährige mit einer Punkband herum und kümmert sich um Licht, Ton und Sicherheit. Merkt er, dass er gerade zu viel Heroin nimmt, wechselt er auf Alkohol und andersherum. „Ich habe einen Teufel mit dem anderen bekämpft“, sagt er. „Das ist ein Teufelskreis, in den man schnell reinrutscht und ohne professionelle Hilfe auch nicht rauskommt“, sagt auch Katharina Dunker. Sie ist Bereichsleitung bei Bethel.regional, einem Stiftungsbereich der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel und leitet unter anderem das Haus, in dem Steve B. heute lebt. Die beiden kennen sich gut, denn sie war einst seine Bezugsmitarbeiterin.

Im Jahr 2000 versucht Steve B. zum ersten Mal aus Halle und vor den Drogen zu flüchten. Er kommt in Mönchengladbach bei Freunden unter. Doch die Sucht lässt ihn nicht los, ein Streit mit den Freunden eskaliert und nach knapp einem Jahr ist er zurück in der Heimat, die er eigentlich hinter sich lassen wollte. Inzwischen weiß Steve B., dass er Situationen immer wieder absichtlich zur Eskalation brachte, um anschließend guten Gewissens mit Drogen darauf reagieren zu können.
Zurück in Halle steht er vor verschlossenen Türen. Weil die Familie ihn nicht mehr aufnehmen möchte, schläft er bei verschiedenen Freunden. Steve B. ist praktisch obdachlos. Erneut kehrt er der Heimat den Rücken zu. Zusammen mit seiner Freundin zieht er in einen Vorort von Konstanz an den Bodensee, arbeitet in der Schweiz – zumindest anfangs. Clean wurden die beiden auch hier nicht. „Das war der Horror“, sagt er. Ganz allein veranstalteten die beiden „Saufgelage“ und lassen sich „den Stoff mit der Post schicken“.
Dreieinhalb Jahre im Gefängnis
Wieder folgt die Rückkehr nach Halle. „Dort fiel ich zitternd aus dem Zugabteil“, sagt Steve B. Seine Freundin, die 2003 auch seinen Sohn zur Welt bringt, habe ihm dann erst einmal was besorgt. Es folgen drei harte Jahre: Obdachlosigkeit, Suchtkrankheit und gescheiterte Substituierung mit Drogen-Ersatz-Medikamenten, Vorstrafen, U-Haft. Zwischen 100 und 150 Euro musste er täglich für Drogen ausgeben, um seinen Konsum zu decken. Und woher nehmen, wenn nicht stehlen? „Ich habe aber nie jemandem etwas getan, nie einer Oma die Handtasche weggenommen und nie meine Familie beklaut.“ Das ist ihm wichtig.

2006 landet Steve B. im Gefängnis. „Die Haft war für mich ein sozialer Aufstieg“, sagt er heute. Bei Haftantritt ist er abgemagert und wiegt nur noch 66 Kilo: „Mit der Strafe hat mir der Richter wohl das Leben gerettet.“ Im Leipziger Haftkrankenhaus werden ihm Medikamente gegen die Suchterkrankung gegeben.
Insgesamt verbringt er dreieinhalb Jahre im Gefängnis. Hier konsumiert er zwar weniger, aber an ein Aufhören ist nicht zu denken: „Alles, was es draußen gibt, gibt es auch in der JVA“, sagt er. Dennoch gefällt ihm die Haft. Endlich gibt es wieder klare Regeln, innerhalb derer er sich trotzdem ausleben kann. Andere Häftlinge unterrichtet er in Sachen Elektrotechnik. „Ich bin wahrscheinlich einer der einzigen Menschen, die traurig waren, als sie aus dem Gefängnis rauskamen.“
Drei Flaschen Schnaps am Tag
Wieder frei, haut er gleich die Hälfte seines angesparten Haftgelds auf den Kopf – und geht im folgenden Entzug gleich die nächste problematische Beziehung ein. Mit seiner neuen Freundin zieht er zu ihren Eltern aufs Dorf und arbeitet als Elektriker. Aber: „Zwei Ertrinkende können sich nicht retten“, sagt er. Und zwei Trinkende eben genauso wenig. Denn auch die neue Freundin ist suchtkrank. „Der Notarzt musste abwechselnd sie oder mich mitnehmen.“ Einmal lagen nur vier Stunden zwischen zwei Einlieferungen. Am Kiosk an der Bushaltestelle hatte er schon wieder angefangen zu trinken. Immer wieder schlagen die Entzüge fehl.

Wieder einmal im Krankenhaus, hat seine neue Partnerin plötzlich einen neuen Freund. Das zieht Steve B. den Boden unter den Füßen weg. Er zieht sofort aus und wohnt drei Wochen lang im Auto, „wo ich immer maßlos besoffen war“. Der erneute Fall des Pegeltrinkers, der am Ende täglich drei Flaschen Schnaps plus Bier konsumierte, war nicht mehr aufzuhalten. Wieder Obdachlosigkeit, Psychiatrie, der Umzug nach NRW, ein Krankenhausaufenthalt, bei dem ein spät entdeckter Lebertumor entfernt wurde. Ein halbes Jahr lang sei er mit seinen Schmerzen von Arzt zu Arzt gelaufen: „Mir hat keiner geglaubt. Durch die Blume hieß es: ‚Hören Sie auf mit den Drogen und dem Saufen, dann geht es Ihnen auch wieder gut.‘“
Nach der Operation landet er wieder auf der Straße. Aber nur kurz – nach einer Woche wird eine gesetzliche Betreuung angeordnet. „Dann ging meine Bethel-Geschichte los“, sagt er unter Freudentränen.
„Bethel hat mir das Leben gerettet“
2016 landet er in der Castrop-Rauxeler Bethel.regional-Einrichtung „Haus Lange Straße“, drei Jahre später dann in der Schwestereinrichtung „Haus Waldenburger Straße“. Damals leitet noch Katharina Dunkers Vorgängerin Monja Emmel die Einrichtungen. Sie fördert und fordert ihn: „Frau Emmel war die Erste, die in mir etwas zu sah, was ich bis dahin nicht mehr gesehen habe“, sagt Steve B. heute. Sie schlägt ihm vor, in den Nutzerbeirat, die Vertretungen der Bewohner, einzutreten.
„Ich habe das nicht so ernst genommen“, sagt er. Doch langsam führt sie ihn immer einen Schritt weiter. Beim Begrüßungsgottesdienst für die neuen Bethel.regional-Mitarbeitenden hält er die Andacht. Seine Rolle wächst, er wird Beiratsvorsitzender, spricht auf großen Veranstaltungen vor hunderten Menschen. Als das neue Gebäude an der Waldenburger Straße geplant wird, sitzt er im zuständigen Bauausschuss. Seine Perspektive als Bewohner ist gefragt und Steve B. mischt sich ein: „Wir haben im Garten bewusst entschieden, dass das hier ein bisschen hügelig wird, dass wir geschwungene Wege haben, damit das nicht alles so steif aussieht. Keine spitzen Winkel, unterschiedliche Materialien“, erklärt er. Heute sieht es tatsächlich so aus.

Seitdem Steve B. intern eine Ausbildung zum Co-Trainer gemacht hat, gibt er den Bethel.regional-Mitarbeitenden Workshops in Sachen Bundesteilhabegesetz. Durch die Übungen dort soll deutlich werden, wie wichtig es ist, die Perspektive zu wechseln und den Willen der Klienten zu respektieren. Bald soll noch eine weitere Ausbildung hinzukommen, die zum Genesungsbegleiter. Sie dauert 18 Monate und richtet sich an Menschen mit eigenen Krisenerfahrungen, die in Workshops anderen helfen möchten: „Ich möchte das nicht nur für mich machen, sondern auch, damit es anderen gut geht.“
Bis heute nimmt Steve B. Medikamente zur Substitution: „Das ist eine extrem große Hilfe dabei, den Alltag gut zu bewältigen.“ Dass er sie jemals wieder absetzen kann, glaubt er nicht. „Alles in meinem Leben steht und fällt mit der Abstinenz“, weiß er. Genau deshalb will er nie wieder zurück in die Heimat nach Halle. Von den alten Freunden hat er sich „komplett losgesagt“, denn er weiß, wie knapp er an einem schlimmen Ende seiner Sucht vorbeigeschrammt ist. „Man kann sagen, dass Bethel mir das Leben gerettet hat.“
Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel erschien ursprünglich am 24. Juli 2024.