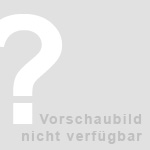Wenn von einer stärkeren Belastung durch die Grundsteuer gesprochen wurde, ging es zuletzt meistens um private und gewerbliche Grundstückseigentümer. Aus dem Rathaus in Fröndenberg kommt jetzt ein Alarmruf: Die kommunalen Haushalte würden ebenfalls belastet – weil ungewiss sei, ob die Regelung in NRW überhaupt verfassungsmäßig ist.
„Es gibt ein Prozessrisiko“, sagt Stadtkämmerer Heinz-Günter Freck. Denn es könne zu vielen Widersprüchen und Klagen gegen die Grundsteuerbescheide für das Jahr 2025 und auch noch danach kommen.
„Verfassungsrechtliche Risiken“ der Hebesatz-Option
Die Ursache sehen er und die kommunalen Spitzenverbände in NRW in einem Gesetz, das der Landtag erst im Juli beschlossen hat und das den Städten und Gemeinden eigentlich helfen soll, eine „Unwucht“, wie Freck es nennt, aus der Grundsteuerreform heraus zu wuchten.
Ein Gutachten indes, das die kommunalen Spitzenverbände eingeholt haben, komme zu dem Ergebnis, dass ein in NRW eingeführter „differenzierter Hebesatz“ bei der Grundsteuer – einen niedrigeren für Wohngrundstücke und einen höheren für Gewerbeflächen – verfassungswidrig ist.
Rechtsprofessor Steffen Lampert von der Universität Osnabrück kommt derweil zu dem Schluss, dass die damit eintretende steuerliche Ungleichbehandlung rechtlich problematisch sei und daher „verfassungsrechtliche Risiken“ bei dem NRW-Gesetz bestünden.
Heinz-Günter Freck und viele seiner Kollegen in den Kämmereien befürchten daher, dass eine Welle von Widersprüchen und Klagen mit einem völlig ungewissen Ausgang droht. Es hänge quasi ein Damoklesschwert über den Steuereinnahmen und damit auch über den Haushalten der nächsten Jahre.
Rückstellungen für eventuelle Rückerstattungen
Kämmerer Freck muss sämtliche beklagten Bescheide in „Rückstellungen für ungewisse Prozessrisiken“ im Haushalt abbilden. In Fröndenberg rechnet der Finanzmann mit 500.000 Euro für ein Haushaltsjahr, die zurückerstattet werden müssen, wenn die Kläger Erfolg haben. „Eingesammelt wird das Geld“, so Freck. Denn Rechtsmittel gegen Steuerbescheide heben die Zahlungspflicht grundsätzlich nicht auf.
Im schlimmsten Fall sammele sich eine Summe von vielen Millionen an. Denn Steuerprozesse würden bis zu einem Urteil in aller Regel sehr lange dauern. „Unsere allgemeine Rücklage wird damit weiter reduziert“, erklärt Freck – und damit rücke auch die Gefahr näher, den ohnehin fast platzenden städtischen Haushalt frühzeitig nicht mehr ausgleichen zu können.
Auslöser der ganzen Problematik ist die Neubewertung sämtlicher Grundstücke durch die Finanzämter. Dabei hatte sich herausgestellt: Wird ein einheitlicher Hebesatz für alle Grundstücke ohne Unterschied bei ihrer Nutzung angewendet, werden Wohngrundstücke deutlich stärker belastet als Gewerbeflächen. Dabei sind 2024 schon vielerorts die Hebesätze erhöht worden.
Die Grundsteuer B für gewerblich genutzte Grundstücke würde hingegen in den meisten Fällen sehr stark sinken, weil ihr Messbetrag nach der Neubewertung durch das Finanzamt viel kleiner ist als vor der Reform.
Steuerlast für Gewerbeflächen sinkt tendenziell
Entscheiden sich Kommunen dafür, Eigentümer von Wohnimmobilien von einer übermäßig hohen Steuerpflicht zu entlasten und führen eine Art Grundsteuer-Splitting ein, laufen sie allerdings in das beschriebene Prozessrisiko.
Das Land, so Rechtsprofessor Lampert, habe mit dem differenzierenden Hebesatz „punktuelle Eingriffe“ in das Bundesgesetz vorgenommen, weil das Ergebnis der Reform mit den stark unterschiedlichen Belastungen von Wohn- und Nichtwohngrundstücken in NRW politisch nicht gewollt gewesen sei.
Ein Gutachten des Landes kommt hingegen zu dem Ergebnis, dass das Grundsteuer-Splitting verfassungsmäßig sei – solange der Hebesatz für Gewerbeflächen nicht doppelt so hoch wie jener für Wohngrundstücke sei.
Die Städte und Gemeinden seien auch noch aus einem anderen Grund die Leidtragenden der Grundsteuerreform, erläutert der Fröndenberger Kämmerer. Bereits am Ort angesiedelte Unternehmen hätten ihre Belastung durch die Grundsteuer gering halten können, weil sie den Wert ihrer Gewerbefläche durch Abschreibungen klein rechnen durften.
Kommunen können einheitlichen Hebesatz wählen
Ein Betrieb, der sich auf einer Fläche am Ort neu ansiedeln wolle, könne aber noch gar keine Abschreibungen geltend machen, er werde damit stärker von der Grundsteuer belastet. „Das ist ansiedlungsfeindlich“, kritisiert Freck.
Von „Verteilungsgerechtigkeit“ spricht Heinz-Günter Freck, die mit der Grundsteuerreform angestrebt worden sei. Nun könne dieses Postulat, das auch das NRW-Hebesteuer-Gesetz verfolge, die Kommunen wegen der Ungleichbehandlung von Grundstückseigentümern – ebenfalls „eine Umverteilung“, so Freck – ein weiteres Mal vor Probleme stellen.

Die aufkommensneutralen differenzierenden Hebesätze hat das NRW-Finanzministerium den Kommunen als Anhaltspunkt zur Verfügung gestellt. Städte und Gemeinden können hiervon abweichen. An der Problematik änderte dies aber nichts.
Denkbar ist auch, dass sich die Lokalpolitik in einzelnen Kommunen für einen einheitlichen Hebesatz entscheiden. Das Risiko dann ist ein großer Unmut bei vielen Hauseigentümern wegen ihrer künftig viel stärkeren Steuerbelastung. Und in fünf Kommunen – Bergkamen, Holzwickede, Lünen, Schwerte und Selm – liegt der differenzierte Hebesatz für Besitzer von Wohngrundstücken sogar leicht unter dem aktuellen Satz von 2024.
Heinz-Günter Freck weiß nicht, wie der Rat in Fröndenberg entscheiden wird, stellt sich auf jedes Szenario ein. Denn droht nicht das Risiko des Volkszorns, wird stattdessen das Prozessrisiko real. Angenehmer dürfte das nicht werden. Freck: „Unterliegen wir, spielen wir alles zurück – mit Zinsen.“