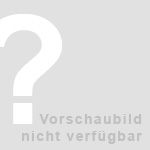Faszination hat Prof. Dr. Dietwald Gruehn in der Stimme, wenn er über den Phoenix-See im Süden von Dortmund spricht. Knapp sieben Kilometer Luftlinie entfernt befindet sich sein Arbeitsplatz an der TU Dortmund. Der Professor für Landschaftsökologie und Landschaftsplanung ist Dekan an der Fakultät für Raumplanung.
Wie bewertet er das neu geschaffene Gewässer und seine Umgebung voller höherklassigen Wohnhäuser, Gastronomie und Co.? „1,5 – also zwischen gut und sehr gut“, sagt der Fachmann – vor allem, weil ehemalige Industriebrachen wieder genutzt wurden. Und ist ein zweiter Phoenix-See in Dortmund denkbar? Das steht für Gruehn außer Frage: „Die Stadt Dortmund hat gezeigt, dass sie so ein Projekt stemmen kann.“ Bei dem nun anvisierten Gelände im Westen fallen ihm aber einige Warnsignale auf. Begraben müsste die SPD ihre Pläne deswegen aber nicht gleich: „Um Fehlplanungen zu verhindern, sollte der Standort jedoch zunächst im Detail geprüft werden, was planungsrechtlich aber ohnehin getan werden müsste“, bemerkt der Landschaftsplaner. Was ihn alarmiert:
1. Hochwasser-Gefahr
Der künstliche See auf dem ehemaligen Stahlwerksstandort Phoenix-Ost in Dortmund-Hörde sei eine „elegante Lösung“, sagt Prof. Dr. Gruehn. Nachdem die Industrie nach knapp 100 Jahren eine Brachfläche hinterlassen habe, seien die gegebenen Strukturen clever ausgenutzt worden. So ist die nördliche, nach Süden exponierte Seite des Sees inklusive der angrenzenden Wohnbebauung aufgrund der topografischen Verhältnisse etwas höhergelegen. Die Gebäude stehen durch den dazwischenliegenden Weg auch nicht direkt am Ufer, „so dass die Häuser bzw. Keller der Anwohner bei Starkregenereignissen nicht gleich volllaufen können“, resümiert Gruehn.
Ganz anders sieht es am Mastbruch in Dortmund-Westerfilde, dem potenziellen Phoenix-See-2.0-Standort aus. „Das Wort ,Bruch‘ gibt schon an, dass der Standort etwas tiefergelegen ist. So wie zum Beispiel das Wort ,Niederung‘“, sagt Landschaftsplaner Gruehn. Und dort sammelt sich – logischerweise – Wasser. Was zunächst nach einer guten Voraussetzung zur Errichtung eines künstlichen Gewässers klingt, birgt aber für größere Bauprojekte Gefahren. Weil zudem noch die Böden im Norden der Stadt generell weniger Wasser speichern als im Süden und das Wasser in dem „Bruch“ gesammelt wird, steigt dort die Hochwasser-Gefahr.

2. Naturschutz-Problem
Rückblickend war das ehemalige Stahl- und Eisenwerk Hermannshütte der perfekte Standort für die visionäre Planung des Phoenix-Sees. 100 Hektar Fläche lagen brach und standen zur Umnutzung bereit. Heute ist das Areal nicht wiederzuerkennen. Kontrastprogramm dagegen in Westerfilde. Die Bezirksregierung Arnsberg hat die Fläche zwischen Westerfilde und Jungferntal am 19. Juni 1986 als Naturschutzgebiet ausgewiesen. 1990 wurde es in den Landschaftsplan Dortmund-Nord übernommen. Das blieb auch nach der ersten Änderung im Jahr 2005 so. Es ist Teil des Rahmer Waldes. Eichen und Rotbuchen wachsen hier.

Die Stadt habe die Möglichkeit, das Areal von seinem Naturschutz-Status zu befreien, erklärt Prof. Dr. Gruehn. Das würde sich aber sicherlich verzögernd auf die großen Phoenix-See-2.0-Pläne auswirken und sei inhaltlich fragwürdig. „In der Ausbildung von Raumplanern und Raumplanerinnen raten wir davon ab, Naturschutzgebiete zu verplanen“, sagt der TU-Professor. Deutschland sei bereits „völlig zersiedelt“, die wenigen städtischen Naturschutzgebiete seien daher wichtig, nicht nur für die Natur, sondern auch für die Menschen. Zumal im Vergleich mit ländlichen Gebieten dort vergleichsweise viele bedrohte Arten zu finden seien. „In ländlichen Gebieten sind die Böden häufig mit Dünger und Pestiziden belastet“, so dass städtische Ökosysteme für das Überleben vieler Arten nicht unerheblich seien, erklärt Gruehn. „Wäre so ein Projekt nicht auf der nächsten großen Alt-Industriefläche sinnvoller?“, fragt sich der Fachmann.
3. Autobahn vor Luxushäusern
Einen dritten großen Kritikpunkt sieht Prof. Dr. Gruehn in der nahegelegenen Autobahn A45. Eines der raumplanerischen Grundprinzipien sei die „räumliche Trennung unverträglicher Nutzungen“, sagt er. Hier also Wohnen und Verkehr. „Und es sollen ja nicht irgendwelche Häuser werden“, ergänzt der Raumplaner. Direkt am Phoenix-See sind eher höherpreisige, luxuriösere Häuser entstanden. Das Interesse potenzieller Käufer sieht er im Falle einer Lärmbelastung weniger gegeben. Zwar gebe es Möglichkeiten, eine Autobahn „komplett einzuhausen“. Das würde aber, wenn überhaupt, nur in dicht bewohnten Innenstädten realisiert werden, „weil es extrem teuer ist.“ Im Gegensatz zu Bahntrassen beschallt eine Autobahn zudem sehr kontinuierlich, fast rund um die Uhr.
Das Fazit
Das Leuchtturm-Projekt Phoenix-See in der eigenen Stadt zu kopieren, hält Prof. Dr. Dietwald Gruehn aber keineswegs für ein Hirngespinst. „Dass die SPD nicht nur Pläne hat, sondern auch die Machbarkeit prüfen will, ist erst einmal gut“, sagt Gruehn anerkennend. Er verweist aber auch darauf, dass im Rahmen einer umfassenden Standortsuche gegebenenfalls besser geeignete Flächen gefunden werden könnten, wo die angesprochenen Probleme nicht bestehen. Es sei aufgrund der unterschiedlichen räumlichen Eigenschaften auch nicht ungewöhnlich, dass ein Projekt, das wunderbar an eine Stelle hinpasst, an einem anderen Ort völlig ungeeignet wäre und sich nicht kopieren lässt.
„Westerfilde ist kein Hörde“, sagt er und spricht dabei nicht allein von demografischen und sozialen Strukturen, sondern den räumlichen und landschaftlichen Gegebenheiten vor Ort. Faszination für den Phoenix-See-2.0 könnte jedenfalls dann entstehen, wenn ein in räumlich-landschaftlicher Hinsicht grundsätzlich geeigneter Standort gefunden ist.
Hinweis der Redaktion: Der Artikel erschien erstmals am 11.07.2024.